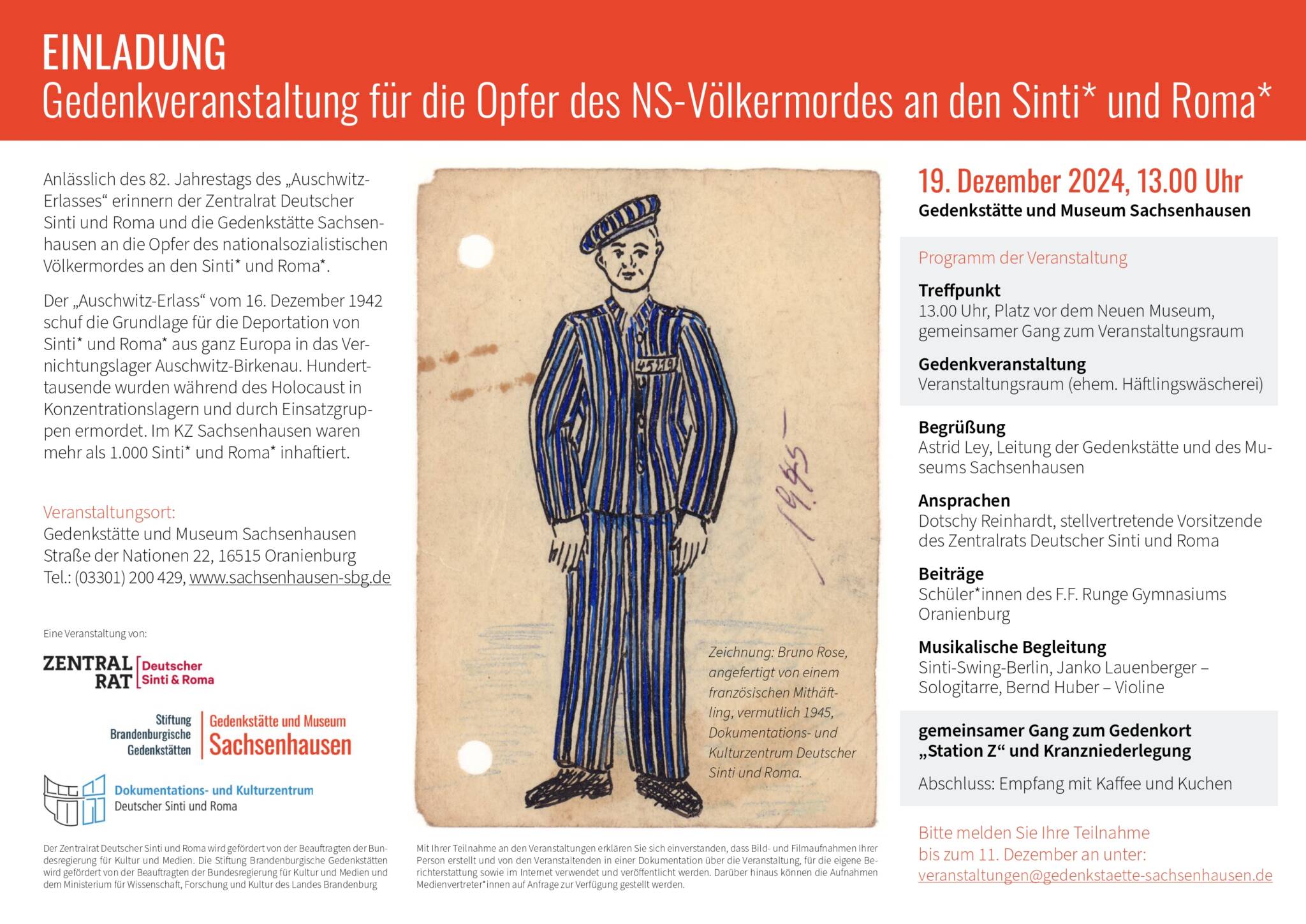
82 Jahre nach der Unterzeichnung des „Auschwitz-Erlasses“ durch Heinrich Himmler wurde heute in der Gedenkstätte Sachsenhausen der Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes an Sinti und Roma gedacht. Die stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Dotschy Reinhardt, und die brandenburgische Kulturministerin Manja Schüle legten am Gedenkort „Station Z“ Kränze nieder. Zuvor hatten Schülerinnen und Schüler des F.F. Runge Gymnasiums in Oranienburg Textpassagen aus Erinnerungsberichten von verfolgten Sinti und Roma vorgetragen.
Astrid Ley (Leitung Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen) sagte: „Über 1000 Sinti und Roma waren zwischen 1936 und 1945 im KZ Sachsenhausen inhaftiert, wo sie – ähnlich wie die jüdischen Gefangenen – unter besonders schlimmen Haftbedingungen litten. Nur knapp ein Viertel von ihnen erlebte das Kriegsende. 400 deutsche Sinti und Roma wurden im KZ Sachsenhausen überdies anthropologischen Zwangsuntersuchungen unterzogen, um ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Gesellschaftliche Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus und Antiziganismus hatten dem NS-Genozid an den Sinti und Roma den Weg bereitet. Auch heute sind Angehörige der Minderheit alltäglich Diskriminierung ausgesetzt. Unsere heutige Gedenkveranstaltung ist daher auch der Appell, endlich gleiche Rechte und einen wirksamen Schutz vor Verfolgung, Hetze und Diskriminierung für Sinti und Roma zu schaffen.“
Dotschy Reinhardt erklärte: „Der Holocaust an 500.000 Sinti und Roma im NS-besetzten Europa wurde jahrzehntelang geleugnet, ignoriert und verdrängt. Für unsere Minderheit, aber auch für das Zusammenleben in unserem demokratischen Rechtsstaat hatte dies dramatische Folgen. Zahlreiche Angehörige unserer Minderheit verheimlichten diesen Teil ihrer Identität aus Angst vor weiterer Verfolgung und Ausgrenzung, denn die Täter des Naziregimes wurden weitgehend bruchlos wieder in die Gesellschaft aufgenommen, was für die Opfer ein unfassbarer Schlag war. Der Antiziganismus war in der Bundesrepublik nicht verschwunden, sondern wirkte in Politik, Bürokratie und Gesellschaft weiter. Er zeigt sich heute zum Beispiel in der Mitte-Studie und der Autoritarismus-Studie, wo weiterhin die Mehrheit der Menschen angibt, dass sie es nicht gutheißen, wenn Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft leben.“
Kulturministerin Manja Schüle sagte: „Wir erinnern heute an die Opfer des grausamen Völkermords der Nationalsozialisten an den europäischen Sinti und Roma – in dem Wissen, dass Anfeindungen und Ausgrenzungen schon lange vor 1933 begannen und leider auch nach 1945 nicht endeten. Ein bedrückendes Beispiel dafür ist der in Ostpreußen geborene Otto Rosenberg, der als Einziger von elf Geschwistern den Völkermord überlebt hatte. Seine Klage auf Entschädigung wurde in den 1950er Jahren dann mit der Begründung abgewiesen, er sei ‘kein echter Deutscher‘. Otto Rosenberg war kein Einzelfall. Wir verdanken es der Bürgerrechtsbewegung und dem Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma, dass wir inzwischen an die Verbrechen der Nationalsozialisten und die jahrhundertelange Verfolgung erinnern. Es ist Zeit dafür zu danken, was die Überlebenden und Nachkommen in Deutschland geleistet haben und noch immer leisten – für die Integration, für das demokratische Miteinander, für unsere Erinnerungskultur. Und es ist mehr als Zeit, klar festzustellen: Sinti und Roma
gehören unwiderruflich zu unserer Gesellschaft, unserer Geschichte, unserer Kultur.“
Der „Auschwitz-Erlass“ vom 16. Dezember 1942 schuf die Grundlage für die Deportation von Sinti und Roma aus ganz Europa in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Mehrere hunderttausend Sinti und Roma wurden im Holocaust in Zwangslagern und durch Einsatzgruppen von den Nationalsozialisten ermordet.



